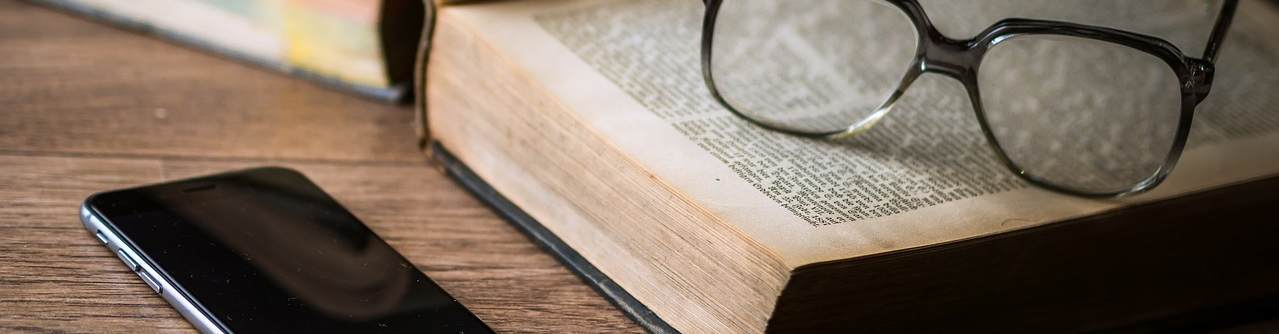Nachschlag! Wer macht was?
Schlag nach. Mach mit. Schlag vor!
„Wer ist eigentlich dafür zuständig?“, „Warum musste das sein?“ oder „Warum geht das nicht anders?“ sind Fragen, die in der Bevölkerung in Hinblick auf Maßnahmen und Entscheidungen im behördlichen Umfeld immer mal wieder aufkommen. Je ärgerlicher ein Umstand, desto lauter. In der Rubrik „Nachschlag“ will die Gemeinde Quierschied diese und andere zentrale Fragen zu aktuellen Themen beantworten. Auch Vorschläge aus der Bevölkerung zu möglichen Themenschwerpunkten sind stets willkommen und werden per Email an mail@quierschied.de oder unter Tel.: 06897 961-102 entgegengenommen.
Seit den 1970er Jahren fördern Bund und Länder Investitionen in die Erneuerung und Entwicklung der Städte und Gemeinden, um diese nachhaltig als Wirtschafts- und Wohnstandorte zu stärken und städtebauliche Missstände dauerhaft zu beheben. Die Gemeinde Quierschied wurde 2011 in das Programm der Städtebauförderung aufgenommen. Die Programmaufnahme ruht auf drei Säulen:
- der Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes,
- -darauf aufbauend- der Erstellung von Teilräumlichen Konzepten bzw. Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepten und
- der förmlichen Festlegung eines Fördergebietes bzw. Sanierungsgebietes.
Derzeit gibt es förmlich festgelegte Sanierungsgebiete in den Ortsteilen Quierschied, und Fischbach-Camphausen. Die Vorteile für Eigentümer:innen im Sanierungsgebiet: Sie haben die Möglichkeit, Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zur Behebung städtebaulicher Missstände und baulicher Mängel an ihren Gebäuden gem. §§ 7 h, 10 f und 11a Einkommensteuergesetz (EStG) über die Dauer von bis zu 12 Jahren bis zu 100% steuerlich abzuschreiben. Die Regelungen des EStG setzen eine entsprechende Bescheinigung der Gemeinde voraus. Vor Beginn der Maßnahme wird eine Vereinbarung über die Durchführung von Modernisierungs- / Instandsetzungsmaßnahmen mit der Gemeinde abgeschlossen. Ausgleichsbeträge fallen in Sanierungsgebieten im vereinfachten Verfahren nicht an.
Im Sanierungsgebiet wird seitens der Gemeinde bei Grundstücksgeschäften, u. a. zum Beispiel bei der Veräußerung oder Teilung eines Grundstücks sowie ferner bei der Änderung oder Aufhebung einer Baulast, eine schriftliche Genehmigung (sanierungsrechtliche Genehmigung) ausgestellt.
Ob auch Ihre Immobilie in einem Sanierungsgebiet liegt und was Sie tun müssen, um von der Förderung zu profitieren, finden Sie neben weiteren, stets aktualisierte Informationen HIER (einfach anklicken).
Grundsätzlich gilt: Der Baubetriebshof der Gemeinde Quierschied hat für die innerörtlichen Bundes- und Landstraßen sowie öffentliche Gebäude die Räum- und Streupflicht! In den nachgeordneten Straßen und vor allem dort, wo die Straßenbreite 3,50 Meter unterschreitet, sind grundsätzlich und zunächst bis zur Straßenmitte die Anlieger selbst zuständig. Die Gemeinde wird bei der Umsetzung des Winterdienstes von der BBL-Gruppe als Auftragnehmer unterstützt.
Außerdem besteht für Eigentümerinnen und Eigentümer anliegender Grundstücke die Gehwege-Räumpflicht. Die entsprechenden Rechten und Pflichten in der Gemeinde Quierschied sind in der „Straßenreinigungssatzung“ geregelt, die HIER (einfach anklicken) abgerufen werden kann.
Darüber hinaus arbeitet das Team des Baubetriebshofs auch alle weiteren öffentlichen Straßen im Gemeindegebiet ab - obwohl kein gesetzlicher Anspruch darauf besteht!
Aus Gründen der Verkehrssicherheit obliegt der Winterdienst einem strengen Organisationsplan, den die Gemeinde genau einhält. Demnach werden die sogenannten „Haupterschließungsstraßen“ zuerst vom Schnee befreit, danach die „Anliegerstraßen“.
Dies gelingt umso besser, je weniger Fahrzeuge so ungünstig geparkt werden, dass für die großen Räumfahrzeuge kein Durchkommen ist.
Dass es im Falle von Schnee und/oder Eis auf den Straßen und Gehwegen zu Verzögerungen bei der Reinigung der Straßen kommen kann, liegt in der Natur der Sache: Die Dauer der Reinigungen variiert je nach Lage und Aufwand vor Ort, was wiederum Auswirkungen auf den weiteren zeitlichen Ablauf hat. Das gilt insbesondere für unvorhergesehene, heftige Schneefälle. Trotz in der Regel zuverlässiger Wetter-Vorhersagen bleiben solche Ausnahmesituationen nicht aus und stellen die Mitarbeitenden des Winterdienstes vor große Herausforderungen. Nicht nur in diesen Fällen wären Geduld, Besonnenheit und Verständnis von allen Seiten angemessen.
Ohne sie wären die meisten Kommunen im Saarland und auch darüber hinaus praktisch nicht handlungsunfähig – vor allem, was Baumaßnahmen betrifft: Die Rede ist von Förderprogrammen von Land, Bund und EU.
Beispiel Nummer 1: Zwischen 2018 und 2023 wurde Kommunen ermöglicht, im Rahmen des sogenannten Kommunalen Investitionsförderungsgesetze I und II in Maßnahmen mit den Schwerpunkten Infrastruktur oder Bildungsinfrastruktur zu investieren. Die Gemeinde Quierschied hat dieses Förderprogramm des Bundes in erheblichem Maße genutzt und so eine Gesamtinvestition von rund 1,7 Millionen Euro realisiert – bei einem Eigenanteil von gerade einmal zehn Prozent, also rund 170.000 Euro.
Beispiel Nummer 2: Seit 2014 nutzt die Gemeinde Quierschied Programme der Städtebauförderung, um die Ortsmitten der drei Gemeindebezirke neuzugestalten. Angefangen mit der Ortsmitte von Göttelborn, die bereits im Jahr 2016 fertiggestellt wurde, läuft mit der Neugestaltung des Triebener Platzes gerade die letzte Baumaßnahme in Quierschied und noch 2024 wird mit ersten Maßnahmen in Fischbach-Camphausen begonnen. Insgesamt wurden bisher rund 6,2 Millionen Euro investiert. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt bei Städtebauförder-Projekten in der Regel bei einen Drittel der Gesamtkosten, in manchen Fällen wie beispielsweise bei der Nachnutzung der ehemaligen Rathausfläche (EU-Mittel) oder der Erneuerung des Triebener Platzes (Programm „Sondervermögen Zukunftsinitiative“) konnte dieser Anteil durch zusätzliche Mittel auf 10 Prozent gesenkt werden. In Quierschied konnten die Mittel auch dazu genutzt werden, um den Folgen des verheerenden Starkregen-Ereignisses von 2009, dem unter anderem das alte Rathaus samt Kultursaal zum Opfer fiel, zu begegnen und mit dem Bau des Veranstaltungssaals „Q.lisse – Haus der Kultur“ und ihrer Außenlage ein neues, modernes Ortsbild zu erschaffen.
Beispiel Nummer 3: Ende 2020 Vor Jahresende 2020 hatte das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz kurzfristig die Möglichkeit eröffnet, noch nicht abgerufene Fördermittel aus dem Förderprogramm „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“ für umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an den gemeindlichen Grundschulen zu verwenden. Der Gemeinde Quierschied ist es dank der schnellen, aber dennoch fundierten Vorarbeit des Bauamtes gelungen, daran teilzuhaben und zusätzlich zu den bereits geplanten Maßnahmen rund 78.000 Euro in die Grundschulen in Quierschied, Fischbach-Camphausen und Göttelborn zu investieren.
Beispiel Nummer 4: In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Quierschied in allen Gemeindebezirken Bushaltestellen niederflurgerecht, also „barrierefrei“, ausgebaut. Seit 2012 sind so insgesamt rund 1 Mio. Euro aufgewendet worden, um zahlreiche Haltestellen moderner und damit auch die Nutzung des Öffentlichen Personen Nahverkehres an sich für alle attraktiver zu gestalten. Auch diese Maßnahmen wurden vom Land in erheblichem Umfang gefördert, der Eigenanteil der Gemeinde lag in der Regel zwischen 10 und 30 Prozent.
Die große Herausforderung für Kommunen: Um von den Programmen von Land, Bund und EU profitieren zu können, muss man sie zunächst einmal finden. Programme gibt es viele, aber das für den eigenen Bedarf Passende ausfindig zu machen und dann auch zur Anwendung zu bringen, ist die entscheidende Kunst. Es müssen bestimmte Vorgaben erfüllt und entsprechende Anträge gestellt werden. Nicht selten muss dies kurzfristig geschehen, was die zuständigen Ämter vor große Herausforderungen stellt. Auch deshalb ist in den Nachrichten – insbesondere gegen Jahresende – immer mal wieder von Fördertöpfen zu hören, die nicht vollends abgeschöpft wurden und die noch teils erhebliche Restmittel beinhalten.
„Es ist also schon eine Besonderheit, dass wir es als Gemeinde Quierschied seit einiger Zeit immer wieder schaffen, die bestehenden Programme und Töpfe für viele unserer Projekte anzuwenden“, erklärt Bürgermeister Lutz Maurer und betont: „Dafür bedanke ich mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bauamtes. Vor allem mit ihrer Schnelligkeit bei der Ausarbeitung der erforderlichen Unterlagen können wir bei einem verhältnismäßig geringen finanziellen Aufwand immer wieder erhebliche Summen investieren und damit das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gezielt und sinnvoll einsetzen.“
Wichtig: Das Geld, das mit Hilfe von Förderprogrammen verausgabt wird, ist zweckgebunden und ausschließlich für Projekte vorgesehen, die den jeweiligen Vorgaben entsprechen. Es ist also ein Trugschluss zu glauben, dass beispielsweise die 6,2 Millionen Euro aus Beispiel 2 stattdessen für Kitas oder Schulen hätten genutzt werden können. Auch hierfür gibt es eigene Förderprogramme, die von der Gemeinde Quierschied vollumfänglich in Anspruch genommen werden – siehe die Beispiele 1 und 3.
Man kann sie sehen, hören und – wenn man ihnen nicht rechtzeitig ausweichen kann – auch spüren: Straßenschäden. Sie können über Nacht entstehen und treten je nach Jahreszeit und Witterungslage vermehrt auf. Manche werden kurzfristig beseitigt, andere bleiben wochen-, gar monatelang unangetastet und strapazieren die Nerven aller Verkehrsteilnehmenden. Doch wie kann es sein, dass manche Schäden nicht zeitnah repariert werden? Sie ahnen es: Das Geld spielt dabei die entscheidende Rolle. Die Frage der Zuständigkeit ist beim Thema „Straßensanierungen“ hingegen relativ schnell geklärt: Der Bund ist für Bundestraßen wie Autobahnen (Autobahn GmbH) zuständig, das Land (Landesbetrieb für Straßenbau LfS) für Landstraßen und die Gemeinde für die Gemeindestraßen.
Finanzierung
Bekanntermaßen ist das für viele Maßnahmen nötige Kleingeld in den meisten Kommunen im Saarland knapp. Investitionen müssen also auch im Bereich der Straßensanierung wohlüberlegt sein, Abwägungen bestimmen die Entscheidungsfindung.
Grundsätzlich bestimmt die Finanzkraft einer Kommune, wie viel Geld sie für Investitionen in das eigene Straßennetz aufwenden kann. Letztlich beschließt der Gemeinderat alljährlich im Rahmen der Haushaltsberatungen, wie viele Mittel für die Instandhaltung von Straßen in den drei Gemeindebezirken in den Haushalt eingestellt werden. Dabei sind neben wirtschaftlichen Erwägungen auch Vorgaben wie beispielsweise zur Erfüllung des Saarlandpaktes (Rückführung der Kassenkredite) zu beachten.
Über die Eigenmittel hinaus kann es, wie in den vergangenen zwei Jahren geschehen, Zuschüsse des Landes für die Instandhaltung von Straßen geben. Eine direkte Kostenbeteiligung der Bürgerinnen und Bürger, wie es manchen Kommunen eine Straßenausbaubeitragssatzung ermöglicht, gibt es in der Gemeinde Quierschied nicht und die Einführung einer solchen ist auch nicht vorgesehen.
Durchführung
Es ist an den jeweiligen Ortsräten, die im Haushalt zur Verfügung gestellten Mittel möglichst bedarfsgerecht und effizient auf Maßnahmen in ihrem Gemeindebezirk zu verteilen. Hierzu werden in den drei Räten jährlich Prioritätenlisten angelegt, die die anstehenden Maßnahmen nach Dringlichkeit sortiert benennen. Die Gemeindewerke Quierschied sind für die Ausführung der Maßnahmen an den Gemeindestraßen zuständig. Das heißt: Sie schreiben größere Maßnahmen wie die Sanierung ganzer Straßenzüge öffentlich aus, beauftragen bei kleineren Schäden das Jahresvertragsunternehmen (derzeit: Jablonski & Busch GmbH) oder den Baubetriebshof der Gemeinde mit der Reparatur.
2024
Dank eines positiven Einmal-Effektes mit Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer hat die Gemeinde ihre Ausgaben für Straßensanierungen im Jahr 2024 deutlich erhöht. Hier kann, mit Zuschüssen des Landes, annähernd der dreifache Betrag des Vorjahres investiert werden. Aktuelle Maßnahmen sind stets auf Seite 4 des Quierschieder Anzeigers und online unter www.quierschied.de > Rathaus&Service > Baustellen und Sperrungen einzusehen. Hinweise auf neue Straßenschäden können Sie der Gemeinde jederzeit bequem online über den Mängelmelder (www.quierschied.de/maengelmelder) zukommen lassen. Kleinere Reparaturen werden möglichst zeitnah, größere eben gemäß der Prioritätenlisten erledigt.
Grundsätzlich steht die Gemeinde beim Thema Mäharbeiten vor ähnlichen Herausforderungen wie alle privaten Eigentümer von Garten- oder anderweitigen Naturflächen. Das alljährliche Erwachen der Flora findet im Frühjahr statt. Je nach Witterungsverhältnissen recht plötzlich. Folgt in kurzer Zeit eine entsprechende Kombination aus sonnigen und Regentagen, so schießen Gräser, Blumen und andere Pflanzen in kurzer Zeit regelrecht in die Höhe. Erfolgen dann nicht zeitnah Mäharbeiten, erweckt das vereinzelten Unmut.
Doch nicht immer liegt das Ausbleiben oder die Verzögerung beim Mähen öffentlicher Flächen daran, dass der Rasenmäher gerade nicht einsatzbereit ist oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Baubetriebshofs der Gemeinde gerade Drängenderes zu tun hätten. Wobei dies durchaus der Fall sein kann: Gerade im Frühjahr, wenn in der Gemeinde zahlreiche Vereinsfeste nacheinander oder gar zeitgleich stattfinden, werden diese durch den Bauhof unterstützt. Mit Personal und Material, beispielsweise zum An- und Abtransport der Bühnenelemente.
In der Regel handelt es sich allerdings um aktiven Naturschutz. So werden beispielsweise die Brut- und Setzzeiten betroffener Tierarten berücksichtigt, beispielsweise der Stockente als Bodenbrüter. Auch spielt der Insektenschutz eine Rolle. Längere Blühphasen fördern den Arterhalt und damit die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt. Um dies mit den berechtigten Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger in Einklang zu bringen, die so geförderte Natur beispielsweise in der Fischbacher Waldparkanlage genießen zu können, müssen Mäharbeiten an den Rändern der Flächen sowie an Wegen und Sitzgelegenheiten durchgeführt werden.
Seit einiger Zeit liegen darüber hinaus Blühwiesen im Trend, also Flächen, die sich ohne größere Einschnitte des Menschen „wild“ entfalten dürfen. Das schont die Natur, ist sehr förderlich für das Ökosystem und spart gleichzeitig Ressourcen, denn: Diese Wiesen sollten maximal drei Mal im Jahr gemäht werden. Der erste Schnitt zwischen Mitte Mai und Ende Juni drängt die wuchskräftigen Obergräser zurück und schafft das nötige Licht für konkurrenzschwächere Blumen und Kräuter. Der zweite Schnitt sollte erst ab Mitte September erfolgen, da viele Arten zu diesem Zeitpunkt ihre Samenreife noch nicht abgeschlossen haben. Erst dann können im Laufe des Sommers neue Blüten- und Fruchtstände ausgebildet werden.
Der Saarländische Städte- und Gemeindetag informiert
Warum wird die Grundsteuer reformiert?
Mit Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 wurde die bisherige Rechtslage zur Berechnung der Grundsteuer mit dem Grundgesetz für unvereinbar erklärt und gleichzeitig eine Besteuerung anhand aktuellerer Werte ab dem Jahr 2025 verpflichtend vorgeschrieben. Die im Anschluss vom Bund beschlossenen Reformgesetze gelten weitgehend auch im Saarland außer bei den sogenannten Steuermesszahlen. Hier sieht das Saarland eine Differenzierung nach Grundstücksarten vor. Der saarländische Gesetzgeber will hierdurch den wohnlich genutzten Grundbesitz fördern und die infolge der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes eintretende Mehrbelastung wohnlich genutzter Immobilien zumindest mildern.
Was geschieht mit den Einnahmen aus der Grundsteuer?
Die Einnahmen aus der Grundsteuer bleiben vollständig vor Ort und können von den Städten und Gemeinden flexibel eingesetzt werden. Mit der Grundsteuer werden Schulen, Kitas, Straßen und Spielplätze gebaut oder örtliche Kultur- und Sportangebote finanziert. Jeder Euro wird sozusagen direkt vor der Haustür ausgegeben.
Das, was die Städte und Gemeinden lebenswert macht, könnte ohne die Grundsteuer nicht finanziert werden. Die Grundsteuer wird für die örtliche Gemeinschaft gezahlt, allein diese profitiert von ihr. Gerade die finanzschwachen saarländischen Städte und Gemeinden benötigen die Einnahmen aus der Grundsteuer dringend zur Erfüllung ihrer Aufgaben für alle Bürgerinnen und Bürger.
Wie lief die Reform ab?
Die Finanzämter hatten im Saarland im Zuge der Reform rund über 550.000 neue Grundsteuerwerte zu ermitteln und zu bescheiden. Dieser Prozess ist mittlerweile fast abgeschlossen, mehr als 90 % der Grundstücke sind neu beschieden. Für diejenigen Grundstücke, für die die Grundstückseigentümer keine Steuererklärungen abgegeben haben, wurden die Grundstückwerte durch die Finanzverwaltung geschätzt.
Aus diesen Werten und den landesspezifischen Steuermesszahlen werden die Grundsteuermessbeträge im Rahmen der Grundsteuermessbescheide errechnet. Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbescheide werden vom jeweils zuständigen Finanzamt erlassen. Der im Messbescheid ausgewiesene Messbetrag ist für die Ermittlung der Grundsteuer für die Gemeinden verbindlich (Grundlagenbescheid). Sie wenden in einem letzten Schritt auf den Grundsteuermessbetrag ihre Hebesätze an, um die endgültige Grundsteuer zu berechnen. Die Hebesätze gelten jeweils für alle Steuerzahler einer Kommune einheitlich und werden für die neue Grundsteuer ab 2025 neu festgelegt.
Grundsteuerwertbescheid und Grundsteuermessbescheid des Finanzamtes:
Grundsteuerwert x Steuermesszahl = Grundsteuermessbetrag
Grundsteuerbescheid der Kommune:
Grundsteuermessbetrag x Hebesatz = zu zahlende Grundsteuer
Es gibt - wie bisher – vor Ort zunächst zwei Hebesätze: einen für die Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) und einen für die Grundsteuer B (Wohnen und Gewerbe). Optional könnten die Kommunen ab dem Jahre 2025 noch einen dritten Hebesatz für unbebaute baureife Grundstücke beschließen (Grundsteuer C), die Entscheidung hierüber liegt bei den jeweiligen Gemeinde- oder Stadträten.
Die Hebesätze gelten jeweils für alle Steuerzahler einer Kommune einheitlich. Die Gemeinde- und Stadträte der saarländischen Kommunen haben die neuen Hebesätze in ihren Sitzungen vor Versand der Grundsteuerbescheide festgesetzt.
Wie erfolgte die Anpassung der Hebesätze?
Weil sich mit der Reform sämtliche Grundsteuerwerte verändern, mussten alle Gemeinden die Höhe ihrer Hebesätze prüfen und ggf. rechnerisch anpassen. Diese Anpassungen fallen von Kommune zu Kommune unterschiedlich aus. Bei einigen sinken die Hebesätze, bei anderen steigen sie. Hintergrund hierfür sind strukturelle Unterschiede zwischen den Kommunen beim Alter der Gebäude insgesamt und der Nutzung der Bausubstanz.
Das saarländische Finanzministerium hatte im Sommer 2024 in einem Schreiben die Kommunen über die künftige Höhe der Gesamtsumme der Grundsteuermessbescheide in der jeweiligen Gemeinde in einer Spannbreite informiert. Diese Zahlen konnten die Städte und Gemeinden als Grundlage für die Ermittlung der Hebesätze heranziehen. Genauso legitim war die Festlegung der Hebesatze mittels eigener Berechnungen der Kommunen auf der Basis der zu einem bestimmten Stichtag vorliegenden Grundstücksbewertungen des Finanzamtes.
Ziel der Neufestlegung der Hebesätze ist es, das Grundsteueraufkommen bzw. Höhe der Einnahmen der Kommunen aus der Grundsteuer zumindest auf demselben Niveau zu halten wie vor der Reform.
Was heißt das für die Höhe der von den Steuerpflichtigen zu zahlenden Grundsteuer?
Die Höhe der zu zahlenden Grundsteuer richtet sich nach der Wertentwicklung auf der Grundlage des neuen Rechts. Ob der einzelne Grundbesitz hierbei (also ab 2025) als besonders „wertvoll“, weniger „wertvoll“ oder eher „durchschnittlich“ einzustufen ist, darüber entscheidet das neue Grundsteuerrecht des Bundes. Die Verschiebung der Wertverhältnisse ergibt sich unter anderem aus einer unterschiedlichen Entwicklung von einzelnen Grundstückslagen in den Kommunen. Das Grundsteuerrecht des Bundes ist im Grundsteuer-Messbescheid des Finanzamts abgebildet. Das hierbei angewandte Verfahren stellt eine sehr vereinfachte Wertermittlung dar. Gleichwohl werden die tatsächlichen Wertverhältnisse abgebildet und so eine am Wert des Grundbesitzes ausgerichtete gerechtere Verteilung der Steuerbelastung sichergestellt.
Die Gemeinden haben auf diese Wertfeststellung keinen Einfluss. Mit den Hebesätzen werden alle neuen Werte nur noch gleichmäßig hochgerechnet. Das Verhältnis der neuen Werte untereinander, das sich aus dem reformierten Bundesrecht ergibt, wird durch diese Hochrechnung nicht mehr verändert.
Ob dann im Einzelfall ab 2025 mehr Grundsteuer als zuvor bezahlt werden muss, hängt nach dem neuen Grundsteuerrecht des Bundes in erster Linie von der Wertentwicklung des betreffenden Grundbesitzes im Vergleich zum übrigen Grundbesitz innerhalb der Gemeinde ab. Bei der Bewertung spielen verschiedene Faktoren eine Rolle wie z.B. Lage des Grundstückes, Alter des Gebäudes, Umfang von möglichen Modernisierungsmaßnahmen oder die Höhe der Mietniveaustufe in der betreffenden Gemeinde.
Mit der Grundsteuerreform sollte die Erhebung der Grundsteuer auf eine neue verfassungskonforme Grundlage gestellt werde. Ziel war es dabei nicht in der Gesamtbetrachtung die Einnahmen der Kommunen zu erhöhen.
Was bedeutet Aufkommensneutralität?
Der Begriff wird oft missverstanden. Er bedeutet nur, dass die Gemeinde nach Umsetzung der Reform (das heißt ab dem Jahr 2025) ihr Grundsteueraufkommen insgesamt stabil halten kann – also im Jahr 2025 ähnlich viel an Grundsteuer einnimmt wie in den Jahren vor der Reform. Die Reform als solche ist also kein Grund dafür, dass sich das Aufkommen verändert.
Zudem heißt Aufkommensneutralität nicht, dass die jeweilige persönliche Steuerbelastung für ein Grundstück unverändert bleibt. Es ist gerade eine Folge der Reform, dass, orientiert an den aktuellen Wertverhältnissen, im Einzelfall eine Mehr- oder Minderbelastung eintritt.
Denn die Neubewertung orientiert sich nicht mehr an den Verhältnissen des Jahres 1964, sondern an aktuellen Faktoren. So bilden die neuen Grundsteuerwerte beispielweise die tatsächlichen Werte von neuen Immobilien realitätsnäher ab. Dies ist im Prinzip auch dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes geschuldet, wonach das alte Recht im Laufe der Zeit zu gravierenden und umfassenden Ungleichbehandlungen bei der Bewertung des Grundvermögens geführt hat. Für die eigentlich interessante Frage „Warum muss ich ab 2025 mehr oder weniger Grundsteuer bezahlen?“ kommt es also in erster Linie auf die Frage an, welchen Wert das betreffende Grundstück nach dem neuen Recht hat.
Wichtig ist: Obwohl eine Gemeinde aufkommensneutral bleibt, also aus der Grundsteuer im Jahr 2025 nicht mehr einnimmt als vorher, kann sich die individuelle Höhe der im Einzelfall zu zahlenden Grundsteuer ändern.
Darf das Grundsteueraufkommen in 2025 bzw. in den nächsten Jahren überhaupt erhöht werden?
Dies ist rechtlich in jedem Falle zulässig. Es bleibt jedoch dabei: Keine Gemeinde erhöht wegen der Reform das Grundsteueraufkommen!
Allerdings kann es vor Ort in den nächsten Jahren notwendig sein, unter anderen Gesichtspunkten (also unabhängig von der Reform) die Grundsteuer insgesamt angemessen anzuheben. Die Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, ihre Haushalte auszugleichen. Gerade im Saarland haben sich die Kommunen verpflichtet, einen strikten Haushaltskonsolidierungskurs einzuschlagen. Gleichzeitig sollen die Städte und Gemeinden aber auch lebenswert bleiben und zukunftssicher aufgestellt werden. Hierzu sind erhebliche finanzielle Anstrengungen erforderlich. Reichen die Finanzmittel hierfür nicht aus, müssen die Kommunen auch angemessene Steuererhöhungen in Erwägung ziehen. Dies kann allerdings jederzeit passieren und hat nichts mit der Umsetzung der Grundsteuerreform zu tun.
Zu betonen ist, dass keine Stadt oder Gemeinde leichtfertig Steuererhöhungen beschließt. In den Räten, die diese Entscheidung zu treffen haben, sitzen Bürgerinnen und Bürger die sich ehrenamtlich für ihre Gemeinde engagieren und übrigens auch selbst Steuerzahler sind.
Welche Möglichkeiten gibt es bei begründeten Einsprüchen gegen die festgesetzte Grundsteuer?
Sollten begründete Einwände gegen die festgesetzte Grundsteuer vorliegen, stehen den Steuerpflichtigen folgende Möglichkeiten offen:
- Widerspruch gegen den Grundsteuerbescheid:
Innerhalb von 1 Monat nach Bekanntgabe des Grundsteuerbescheids können Sie gegen diesen Bescheid bei der KommuneWiderspruch erheben.
Ein Widerspruch gegen den Grundsteuerbescheid ist allerdings nur bei allgemeinen Fehlern wie z.B. Doppelveranlagungen oder bei Zweifeln am zugrundeliegenden Hebesatz sinnvoll.
- Einspruch gegen den Grundsteuerwertbescheid und/oder den Grundsteuermessbescheid:
Dem Grundsteuerbescheid der jeweiligen Kommune liegen der Grundsteuerwert- und der Grundsteuermessbescheid zugrunde. Korrekturen dieser Bescheide kann nur das zuständige Finanzamt veranlassen. Innerhalb einer Einspruchsfrist von einem Monat nach Bekanntgabe dieser Bescheide können Sie bei dem zuständigen Finanzamt Einspruch einlegen.
Zu beachten ist, dass auch hier die Einhaltung der Frist zur Einlegung eines Einspruchs, da andernfalls der Einspruch als unzulässig verworfen werden muss.
Auch nach Ablauf der Frist von 1 Monat kann eine Änderung des Grundsteuerwertbescheids und Grundsteuermessbescheids in Betracht kommen: Dies setzt aber voraus, dass sich durch die für notwendig erachtete Änderung eine Wertdifferenz von 15.000 Euro im Vergleich zum bisher festgestellten Grundsteuerwert ergibt.
Der Einspruch kann schriftlich oder elektronisch über ELSTER erfolgen. Möglich ist zudem, mit dem zuständigen Finanzamt einen Termin zu vereinbaren und dort den Einspruch zur Niederschrift einzulegen.
Was ist, wenn bereits Einspruch gegen den Grundsteuerwertbescheid/Grundsteuermessbescheid eingelegt wurde?
Wurde bereits gegen den Grundsteuerwertbescheid und/oder den Grundsteuermessbescheid Einspruch eingelegt, ist ein zusätzlicher Widerspruch gegen den Grundsteuerbescheid der Kommune nicht notwendig. In diesem Fall ist auf Erledigung des Einspruchs durch das Finanzamt abzuwarten. Aufgrund des derzeitigen Fallaufkommens kommt es bundesweit, so auch im Saarland, zu längeren Bearbeitungszeiten.
Der Einspruch gegen den Grundsteuerwertbescheid und/oder den Grundsteuermessbescheid verhindert nicht die Fälligkeit der Grundsteuer, es sei denn, es wurde bereits die Aussetzung der Vollziehung beantragt und gewährt.
Was passiert bei Eigentumswechsel?
Bei einer Grundstücksübertragung (z.B. durch Veräußerung oder Erbanfall) erfolgt eine sogenannte Zurechnungsfortschreibung auf den neuen Eigentümer mit Wirkung zum 1. Januar des Jahres, das auf das Jahr des Eigentumsübergangs folgt.
Da die Finanzämter wegen der Grundsteuerreform hoch belastet sind, ist in einigen Fällen diese Zurechnungsfortschreibung noch nicht abgeschlossen. In diesen Fällen wird die Kommune den Grundsteuerbescheid an den vorherigen Eigentümer adressieren. Nach erfolgter Fortschreibung wird die Kommune einen korrigierten Grundsteuerbescheid erlassen.
Rückfragen und Rechtsbehelfe
Haben Sie Fragen, können Sie sich an die folgenden Ansprechpartner wenden:
Fragen zur Bewertung der Grundstücke (Grundsteuerwert):
- telefonisch unter Rufnummer Hotline Finanzamt Saarbrücken 0681 501 6277
- (Mo-Do 08:00 – 15:30, Fr 08:00 – 12:00)
- oder schriftlich über ELSTER oder per Post an das jeweilige Finanzamt
Beachten Sie bitte auch die FAQ‘s zur Grundsteuerreform auf der Homepage der saarländischen Finanzverwaltung:
https://www.saarland.de/mfw/DE/portale/steuernundfinanzaemter/Grundsteuerreform
Bei Fragen hinsichtlich des Hebesatzes oder der Höhe der Grundsteuerzahllast:
- telefonisch unter Rufnummer 06897 961-143
- oder schriftlich per E-Mail an k.musluer@quierschied.de
- oder per Post an Gemeinde Quierschied, Rathausplatz 1, 66287 Quierschied